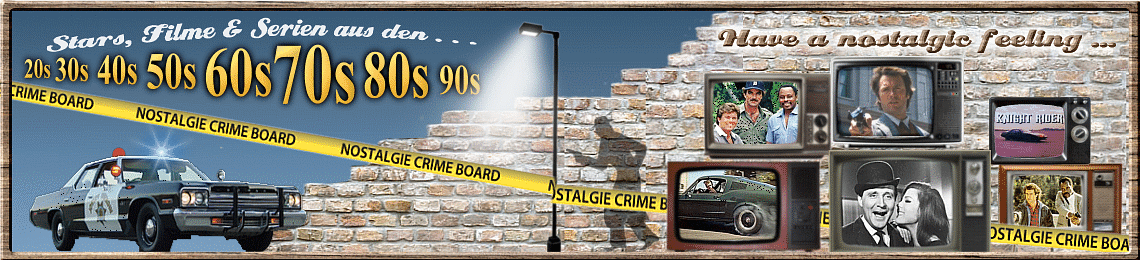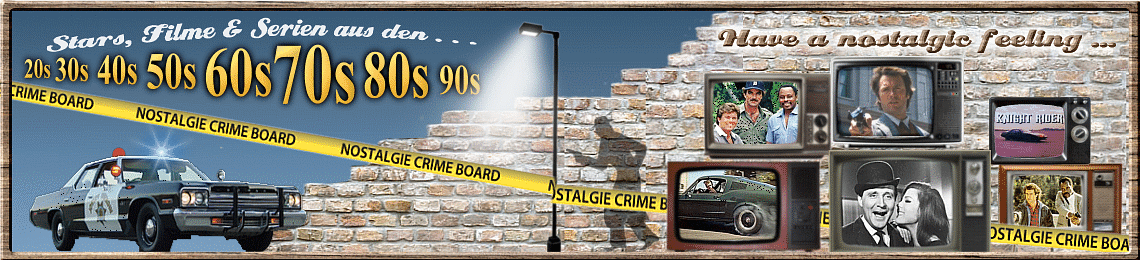Die Liste an bekannten Klassikern und Publikumserfolgen, die auf das Konto von Norman Jewison gehen, ist beachtlich. Da wäre neben den Oscar prämierten Streifen In the Heat of the Night (In der Hitze der Nacht, 1967), Fiddler on the Roof (Anatevka, 1971) und Moonstruck (Mondsüchtig, 1987) auch noch der Gentlemankrimi The Thomas Crown Affair (Tomas Crown ist nicht zu fassen, 1967), die Politfarce The Russians Are Coming the Russians Are Coming! (Die Russen kommen!“, 1966), den Pokerfilm Cincinneti Kid (1965), die Rockoper Jesus Christ Superstar (1972) und die Science Fiction-Dsytopie Rollerball (1975). Nur den Regie-Oscar hat er nie bekommen. Was auch viel mit seiner Bodenständigkeit zu tun hat, die den Kanadier immer dazu trieb, eine gute Geschichte niemals ästhetischen Mätzchen oder intellektuellen Vexierspielen zu opfern - was man ihm schon mal als fehlenden Kunstanspruch ausgelegt hat.
Ungeachtet der Vielseitigkeit des Oeuvres zieht sich der kritische Blick auf Amerika, mit all seinen ethnischen und gesellschaftlichen Asymmetrien, die er auf seinen Reisen als 17-jähriger durch die Südstaaten erforschte, als dickster roter Faden durch sein Werk. Das Boxerdrama Hurricane (1999) und de
r Nazithriller The Statement (2003) sind die jüngsten Zeugnisse dieses sozialkritischen Impetus.
Nach dem Jewison einige Zeit in England gedreht hatte, kehrte er gegen Ende der Siebziger in die USA zurück. Mit dem Gerichtsdrama ...And Justice for All (… Und Gerechtigkeit für alle, 1979) entwarf er eine systemische Innenansicht dessen, was Erving Goffman vielleicht nicht als totale Institution bezeichnet hätte, aber sie kann einem mitunter so vorkommen. Das Justizwesen, dass nach eigenen Regeln operiert, fernab der hohen Ideale. Hier nimmt es sich mehr wie eine Irrenanstalt aus, oder besser: ‚das Haus das Verrückte macht’.
Jewison bekam Al Pacino für die Hauptrolle, und das war mehr als die halbe Miete. (Er wurde für den Oscar im Bereich „Bester Hauptdarsteller“ nominiert. Ebenfalls eine Nominierung gab es für das Drehbuch.) Pacino spielt den Anwalt Arthur Kirkland, ein Staranwalt in Baltimore, der sich bereits in der ersten Szene des Filmes am Rande der Desillusionierung bewegt. Er versucht verzweifelt, einen nachweislich Unschuldigen aus dem Gefängnis zu befreien, doch der zuständige Richter Henry Flemming (John Forsythe) lehnt die Beweisaufnahme ab. Begründung: die Beweise wurden drei Tage zu spät eingereicht. Später wird der arme Kerl verrückt, weil er trotz bewiesener Unschuld nicht aus dem Gefängnis kommt. Der Film ist voll von solch haarsträubenden Schauergeschichten des Justizirrsins- und irrtums. Er zeigt eine Institution, die sogar ihre vermeintlichen Herrscher an den Abgrund treibt. Hier kongenial verkörpert in der tragikkomischen Figur des Richters Francis Rayford (Jack Warden), der stark suizidgefährdet ist und schon mal versucht, sich kurz vor einer Verhandlungen in den Mund zu schießen (und dabei nur den Uvulanerv trifft und sich übergeben muss). Das Blatt scheint sich zu wenden, als gerade eben jener unerbittliche Richter Flemming eines Tages selbst auf der Anklagebank landet. Er soll eine junge Frau vergewaltigt haben. Kirkland wird jedoch durch Erpressung dazu verdonnert, seine Verteidigung zu übernehmen.
„…And Justice for All“ ist, auch wenn man es nach Durchlesen des Klappentextes nicht glauben könnte, kein ausschließlich zorniges Drama, das dem Zuschauer Faustschläge in den Bauch jagd. Diese Faustschläge gibt es natürlich sehr wohl. Jedoch schafft Jewison es auf eigentümliche Art und Weise, so etwas wie Humor in die Handlung einzubringen, die man bei einem solchen Stoff nicht erwartet. Dieser Humor wirkt wie eine Pufferzone, die etwas von der pessimistischen Schärfe aus der Geschichte nimmt, die sonst schwer zu ertragen wäre. Es ist ein Humor, der die Absurdität des Gezeigten nicht konterkarikiert, sondern unterstreicht, und der in der nächsten Sekunde bereits ins Drama kippen kann. So zum Beispiel, als Kirklands befreundeter Anwalt Jay Porter (Jeffrey Tambor) durchdreht und die Menschen im Gericht mit Tellern bewirft. Rayford hält sich die Aktentasche wie einen Schutzschild vor den Oberkörper und versucht zu ihm vorzudringen, Kirkland folgt ihm dicht gedrängt. Dann wird Porter von einem Ärzteteam abtransportiert. Er ist es übrigens, der einen vermeintlichen Freispruchcoup teuer bezahlen muss – sein Mandat war tatsächlich ein schuldiger Mörder. Wie zur Sühne rasiert er sich dann den Kopf kahl.
Auch die Haupthandlung, Kirklands unfreiwillige Verteidigung des Filmfieslings, die ihn vor eine moralische Grundsatzentscheidung stellt, bleibt ein im Grunde dünner Faden in einer sehr zerfaserten Erzählung, in der Jewison sehr viele Nebenkriegsschauplätze errichtet hat. Bemerkenswert ist, dass trotz all dieser Nebenstränge, die für sich genommen einen sehr eng umrissenen Wirklichkeitsausschnitt darstellen und erst in der Summe ihren narrativen Mehrwert abwerfen, absolut stringente und niemals langweilige hundertzwanzig Minuten dabei herausgekommen sind. Mit geschliffen, glasklaren, teils frotzeligen Dialogen.
Lediglich bei der Musik hat sich Jewison grausig vergriffen. Lasziver, gefälliger Coctail-Hochglanz-Pop, typisch für US-Serien der 70´er (Hotel). Er passt wirklich gar nicht ins Gesamtbild, nicht einmal, wenn es sarkastisch gemeint gewesen sein sollte. Jewison hätte lieber, wenigstens im Vorspann, den Song von Randy Newman nehmen sollen. „Oh Baltimore, man it´s hard, just to live…“.
Auch der Schluss bleibt der eigenwilligen Verquickung von Drama und absurdem Theater verhaftet. Kirkland sitzt auf den Stufen des Gerichts, hat im Gerichtsaal gerade die Show seines Lebens abgezogen. Da kreuzt Porter wieder auf. Die Aktentasche fest in der Hand, die Glatze von einem Toupet verdeckt. Er grüßt Kirkland, in dem er sein Haarteil wie einen Hut abnimmt und wieder aufsetzt. Das ist ein Sinnbild für den versteckten Wahnsinn einer Institution, die Menschen entweder stumm oder verrückt macht im Angesicht der Ungerechtigkeit, die sie produziert. Für das Ungleichgewicht zwischen Mensch und System, dass den im amerikanischen Denken so fest verankerten Individualismus negiert. Für die Macht dieser Institution über seine Insassen, die nach jeder noch so großen Katastrophe weitermachen, als wäre nichts geschehen.
Ich bewerte den Film mit